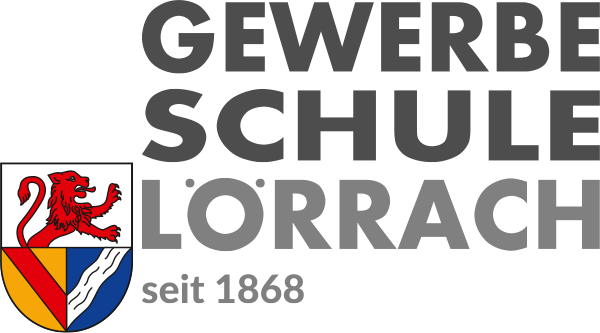Elektroniker*in für Automatisierungstechnik

Berufsbild und Berufsbeschreibung
Elektroniker*innen für Automatisierungstechnik:
- analysieren Funktionszusammenhänge sowie Prozessabläufe von automatisierten Systemen
- entwerfen Änderungen bzw. Erweiterungen.
- installieren und justieren elektrische, hydraulische oder pneumatische Antriebssysteme.
- bauen mess-, steuerungs- und regelungstechnische Einrichtungen ein.
- montieren, konfigurieren, programmieren und justieren sie Sensorsysteme, Betriebssysteme, Bussysteme und Netzwerke.
- verbinden die installierten Komponenten zu komplexen Automatisierungseinrichtungen, die sie in ein Gesamtsystem integrieren. Nach Testläufen übergeben sie die Systeme und weisen die künftigen Anwender in die Bedienung ein.
- lokalisieren, analysieren und beheben Störungen mithilfe von Testsoftware und Diagnosesystemen
- bedienen bzw. warten Elektroniker*innen für Automatisierungstechnik, Automatisierungssysteme und halten sie instand.
Die Berufsschule vermittelt Kenntnisse in folgenden Bereichen:
- Elektrotechnische Systeme analysieren und Funktionen prüfen
- Elektrische Installationen planen und ausführen
- Steuerungen analysieren und anpassen
- Informationstechnische Systeme bereitstellen
- Elektroenergieversorgung und Sicherheit von Betriebsmitteln gewährleisten
- Anlagen und Geräte analysieren und deren Sicherheit prüfen
- Steuerungen für Anlagen programmieren und realisieren
- Antriebssysteme auswählen und integrieren
- Steuerungssysteme und Kommunikationssysteme integrieren
- Automatisierungssysteme in Betrieb nehmen, übergeben und in Stand halt
Anmeldung
Die Anmeldung erfolgt durch den Ausbildungsbetrieb.
Ausbildungsdauer
Die Ausbildung dauert 3,5 Jahre. Der Unterricht findet vierzehntägig in Teilzeit statt.
Unter bestimmten Voraussetzungen (z.B. bei Fachschulreife, Fachhochschulreife oder Abitur) kann zu Beginn der Lehre eine Lehrzeitverkürzung mit dem Ausbilder und der zuständigen Kammer vereinbart werden.
Blockplan (Berufsschultage)
Bücherliste
Fächer
Pflichtfächer:
- Religionslehre
- Deutsch
- Gemeinschaftskunde
- Wirtschaftskompetenz
- Berufsfachliche Kompetenz
- Projektkompetenz
Wahlpflichtfächer
- Betriebliches Englisch
Prüfungen und Abschluss
Die Prüfung besteht aus zwei Teilen:
- Berufsschulabschlussprüfung und
- Gesellenprüfung der Handwerkskammer.
Die schulische Abschlussprüfung und die praktische Zwischen- und Abschlussprüfung erfolgen durch die Kammern und führen zum gelernten Facharbeiter (Haupttermin im November). Der Haupttermin für die schulische Abschlussprüfung ist im November des 4. Ausbildungsjahres.
Die Kammern führen die praktische Prüfung durch:
Abschlussprüfung Teil 2 im Februar des 4. Ausbildungsjahres.
Abschlussprüfung Teil 1 im März bis April des 2. Ausbildungsjahres.
Abschluss
Bei erfolgreichem Bestehen erhalten die Auszubildenden den Facharbeiterbrief (IHK) oder den Gesellenbrief (HWK).
Unter bestimmten Voraussetzungen kann ein mittlerer Bildungsabschluss bzw. eine Fachhochschulreife erworben werden.
zusätzliche Informationen
Ansprechpartner
Wir beraten Sie gerne:

w.gempler@gws-loerrach.de
✆ 07621 429 008

k.strampp@gws-loerrach.de
✆ 07621 429 053

n.baumann@gws-loerrach.de
✆ 07621 429 006